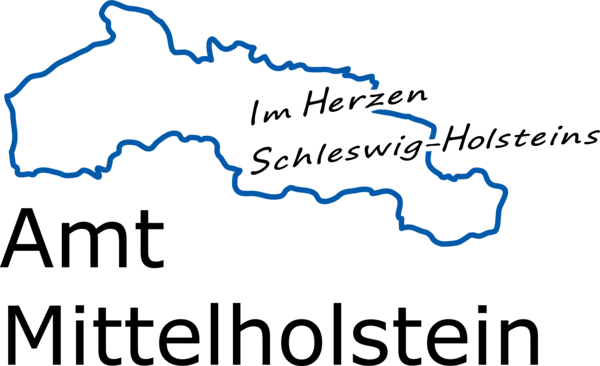Kurzdefinitionen
Diese Kurzdefinitionen liefern präzise Erklärungen zentraler Begriffe rund um Gender, Geschlecht und Diversität – ideal für einen schnellen Einstieg und zur Sensibilisierung im Alltag.
-
Gender Bias
-
Gender Budgeting
-
Gender Diversity
-
Gender Equality
-
Gender Index
-
Gender Kompetenzzentrum
-
Gender Mainstreaming
-
Gender Planning
-
Global Gender Gap: Report & Index